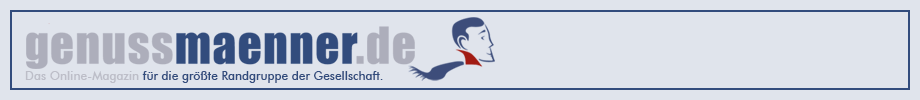Krieg, Flucht, Energie, Klima – viele Krisen treten aktuell gebündelt auf. Unter anderem Vertrauen trägt dabei zum Zusammenhalten und Funktionieren von Gesellschaften bei, ist eine der Quintessenzen der 6. „vechtaer trust lecture“.
Doch sind Proteste durch unterschiedliche Gruppen Ausdruck von starkem Misstrauen in die Demokratie und die politischen Prozesse? Dass dies nicht der Fall sein muss, hat Prof. Dr. Matthias Quent bei der digitalen Veranstaltung des Zentrums für Vertrauensforschung (ZfV) an der Universität Vechta aufgezeigt. Der Wissenschaftler von der Hochschule Magdeburg-Stendal sprach dabei unter dem Thema „Vertrauen – Kitt unserer Gesellschaft?“ über die Bedeutung von Vertrauen und Misstrauen im Kontext des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.
„In meiner vergangenen Eröffnung der ‚trust lecture‘ mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Dr. Seiters durfte ich bereits meine Sorge über das sinkende Vertrauen in die politischen Institutionen zum Ausdruck bringen“, sagte Prof.in Dr.in Verena Pietzner. Doch es gebe auch beispielsweise Studien, die Hoffnung machen würden, dass die Allgemeinheit in Deutschland zufriedener mit der Staatsform Demokratie sei, als noch vor wenigen Jahren, so die Universitätspräsidentin. „Aufgrund der vielfachen Krisenerfahrungen und gewachsenen Unsicherheiten rufen viele Menschen nach einem starken autoritären Staat. Gleichzeitig fühlen sich viele Deutsche ohnmächtig, haben das Gefühl, politisch keinen Einfluss nehmen zu können und sind überfordert durch die steigende Komplexität im Alltag.“ Die entstehenden Zukunftsängste würden Rechtsradikale und rechtsextreme Gruppierungen ausnutzen. Veranstalter Prof. Dr. Martin K.W. Schweer pflichtet bei: Krisen seinen Belastungsproben für den Gesellschaftlichen Zusammenhalt, so der Leiter des ZfV. Vertrauen spiele hier eine wichtige Rolle.
Quent vertieft das Thema. Vertrauen könne als die Erwartbarkeit an eine bestimmte Handlung anderer Menschen oder Institutionen definiert werden, so der Gründer und ehemalige Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena. Beispielsweise könne erwartet werden, dass mit einem Studium und dessen Abschluss die Zusage zu einem gewünschten Job wahrscheinlicher ist, als ohne Studium. Oder aber man vertraut drauf, dass in einer Demokratie die vielfältigen Meinungen berücksichtigt werden und der Mehrheitsentscheid gilt. Bei Krisen hingegen sei dieses Vertrauen gestört.
Quent überträgt die Gedanken auf ein Konstrukt Pierre Bourdieus: Mit Doxa bezeichnet der französische Soziologe alle Überzeugungen und Meinungen, die von einer Gesellschaft unhinterfragt als wirklich oder wahr angenommen werden. Bei der Orthodoxie seien es kollektive Überzeugungen und Wirklichkeitsannahmen, von der die überwiegende Mehrheit der Gesellschaft überzeugt ist. So könne eine Gesellschaft durch allgemein begründetes Vertrauen, beispielsweise in die Wissenschaft oder die Demokratie, stabilisiert werden. Heterodoxie beschreibe hingegen alle Meinungen, Vorstellungen und Behauptungen, die in einer Gesellschaft heftig debattiert würden und umstritten seien, erklärt Quent.
Diese Gegenentwürfe, Widersprüche zum „Mainstream“ würden durch Krisen Zuspruch erhalten. Gezeigt habe sich dies beispielsweis in der Querdenkerszene während der Coronapandemie, so der Wissenschaftler. Und drückt sich durch so entstehende Proteste nun ein Misstrauen in das politische System aus? Nicht unbedingt, meint Quent. Misstrauen sei hier nämlich nicht als Gegenteil von Vertrauen zu sehen. Er nennt als Beispiel die Klimaaktivist*innen der sogenannten „Letzten Generation“. Sie würden durch ihr Handeln zum Ausdruck bringen, dass sie Vertrauen darin haben, etwas durch demokratische Prozesse zu verändern; und dies mit Forderungen, welche den politischen Prozess gar nicht in Frage stellen würden: So zählten dazu unter anderem die Einführung des 9-Euro-Tickets oder des Tempo-Limits sowie Gespräche mit der Bundesregierung. „Damit appellieren sie zutiefst an das demokratische Verfahren“, sagt Quent.
„vechtaer trust lecture“
Die „vechtaer trust lecture no.7“ findet am 6. Juni statt. Stephanie zu Gutenberg engagiert sich seit Jahren zum Thema digitale Bildung und Medienaufklärung und spricht an dem Tag zum Thema „Vertrauen und Misstrauen im Kontext der Digitalisierung“. Das seit dem Sommersemester 2019 laufende Format wird durch Persönlichkeiten aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen mit ihren ganz spezifischen Erfahrungen und Impulsen für die Betrachtung der verschiedenen Facetten von Vertrauen bereichert.
Zentrum für Vertrauensforschung
Mit der Vortragsreihe „vechtaer trust lectures“ wendet sich das Zentrum für Vertrauensforschung (ZfV) an der Universität Vechta unter der wiss. Leitung von Univ.-Prof. Dr. Martin K.W. Schweer an die interessierte Öffentlichkeit. Der Bedeutung von Vertrauen und Misstrauen für die verschiedenen Bereiche gesellschaftlichen Zusammenlebens geht das ZfV seit nunmehr fünfundzwanzig Jahren gezielt nach, um wissenschaftlich fundierte Beiträge zur Lösung konkreter Probleme im sozialen Miteinander leisten zu können.
Vertrauen als Kitt unserer Gesellschaft
„vechtaer trust lecture no.6“
Veröffentlicht am: 29.01.2023
Ausdrucken: Artikel drucken
Lesenzeichen: Lesezeichen speichern
Feedback: Mit uns Kontakt aufnehmen
Twitter: Folge uns auf Twitter
Facebook: Teile diesen Beitrag auf Facebook
Hoch: Hoch zum Seitenanfang