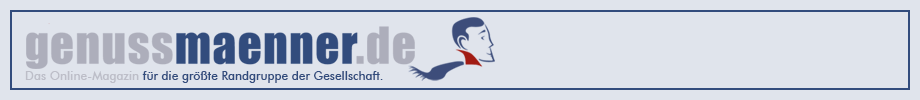Unverheiratete Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz haben weniger Vertrauen in den Umgang mit ihrer Erkrankung und sind in ihrer sozialen Teilhabe stärker eingeschränkt als Verheiratete.
„Diese Unterschiede könnten zu der beobachteten schlechteren Langzeitüberlebensrate bei unverheirateten Patientinnen und Patienten beitragen“, erklärt Dr. Fabian Kerwagen vom Deutschen Zentrum für Herzinsuffizienz Würzburg (DZHI).
Seine Forschungsergebnisse hat der angehende Kardiologe und Nachwuchswissenschaftler heute auf der Heart Failure 2022, einem wissenschaftlichen Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC), vorgestellt. Soziale Unterstützung helfe Menschen bei der Bewältigung von Langzeiterkrankungen. Fabian Kerwagen nennt Beispiele: „Ehepartner können bei der korrekten und regelmäßigen Einnahme der Medikamente unterstützen, Motivation spenden und eine Vorbildfunktion bei der Entwicklung gesunder Verhaltensweisen einnehmen, was sich alles auf die Lebenserwartung auswirken kann.“
Unverheirateten fehlt es häufiger an Selbstwirksamkeit und sozialer Interaktion
Frühere Studien haben gezeigt, dass unverheiratete Personen sowohl in der Allgemeinbevölkerung als auch beim Vorliegen einer koronaren Herzkrankheit eine schlechtere Überlebensprognose haben. Fabian Kerwagen wollte wissen, wie sich der Familienstand bei einer chronischen Herzinsuffizienz auswirkt und analysierte Daten aus der erweiterten INH-Studie (E-INH = Extended Interdisciplinary Network Heart Failure). An der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten E-INH-Studie nahmen 1.022 Personen teil, die zwischen den Jahren 2004 und 2007 aufgrund einer dekompensierten Herzinsuffizienz ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Von den 1.008 Betroffenen, die Angaben zum Familienstand machten, waren 633 (63 %) verheiratet und 375 (37 %) unverheiratet, davon 195 verwitwet, 96 nie verheiratet und 84 getrennt lebend oder geschieden.
Zu Beginn der Studie wurden die Lebensqualität, die sozialen Einschränkungen und die sogenannte Selbstwirksamkeit mit dem Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire erhoben. Dieser Fragebogen wurde speziell für Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz entwickelt. Soziale Einschränkungen beziehen sich auf das Ausmaß, in dem die Folgen einer Herzinsuffizienz die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigen, wie zum Beispiel die Ausübung von Hobbys und Freizeitaktivitäten oder die Interaktion mit Freunden und Familie. Selbstwirksamkeit beschreibt die Einschätzung der Betroffenen, inwiefern sie sich in der Lage fühlen, eine Verschlechterung der Herzinsuffizienz zu verhindern und Komplikationen zu bewältigen. Es gab keine Unterschiede zwischen verheirateten und unverheirateten Patientinnen und Patienten hinsichtlich der allgemeinen Lebensqualität. Allerdings schnitt die unverheiratete Gruppe bei den sozialen Einschränkungen und der Selbstwirksamkeit schlechter ab als die verheiratete Gruppe.
Während der zehnjährigen Nachbeobachtungszeit starben insgesamt 67% der Patientinnen und Patienten. Unverheiratete hatten dabei im Vergleich zu Verheirateten ein um ca. 60 Prozent höheres Todesrisiko, wobei verwitwete Probandinnen und Probanden das höchste Risiko aufwiesen.
Gesundheits-App soll Betroffene unterstützen
Fabian Kerwagen resümiert: „Der Zusammenhang zwischen Ehe und Langlebigkeit illustriert, wie wichtig soziale Unterstützung für Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz ist – ein Thema, das durch die soziale Distanzierung während der COVID-19 Pandemie noch an Bedeutung gewonnen hat.“ Seine Empfehlung: „Das soziale Umfeld sollte bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz berücksichtigt und einbezogen werden. Strukturierte Behandlungsprogramme mit spezialisierten Herzinsuffizienz-Pflegekräften oder Selbsthilfegruppen für Herzinsuffizienz können dabei helfen, um mögliche Lücken zu schließen.“ Aufklärung über das Leben mit einer Herzinsuffizienz sei von entscheidender Bedeutung, gleichzeitig aber müsse auch das Vertrauen der Patientinnen und Patienten in ihre Fähigkeiten zur Selbstversorgung gestärkt werden. Sein Blick in die Zukunft: „Wir arbeiten an einer digitalen Gesundheitsanwendung für das Smartphone, die Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz weitere Unterstützung beim täglichen Umgang mit ihrer Erkrankung bieten soll.“
Fabian Kerwagen hat die Analysen im Rahmen seines Clinician Scientist Programms „UNION-CVD“ (Understanding InterOrgan Networks in Cardiac and Vascular Diseases) durchgeführt. Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte Stipendium bietet eine strukturierte wissenschaftliche Ausbildung für Ärztinnen und Ärzte unter dem Dach des Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung (IZKF) der Universität Würzburg.
Foto: Pixabay