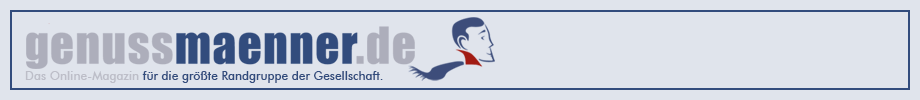Der Siegeszug von Computern und Mikroelektronik seit den 1960er Jahren wird oft als „dritte industrielle Revolution“ bezeichnet. In der DDR stand vor allem der Name Robotron für die neue, alle Bereiche der Wirtschaft verändernde Technologie.
Im Rückblick auf die Geschichte des Kombinats verdichten sich die technischen Möglichkeiten und die daran geknüpften gesellschaftlichen Hoffnungen, aber auch die politischen und ökonomischen Widersprüche, die schließlich zum Scheitern der DDR führten.
Mit Werken von über 20 Künstler*innen nimmt die Ausstellung die Entwicklungen in der Industrielandschaft des ostdeutschen Staates in den Blick. Es geht um Kybernetik und Bürokratie, Spionage und „Reverse Engineering“, das Glücksversprechen der Automatisierung und die Arbeit im „real existierenden Sozialismus“, um Reinräume und Umweltzerstörung, den Verfall einst wichtiger Produktionsstätten und die Re-Industrialisierung im Großraum Dresden als „Silicon Saxony“. Die Fotografien, filmischen Erzählungen, Installationen und grafischen Arbeiten, die zum Teil in der DDR entstanden sind, zeigen die vielfältigen intellektuellen und ästhetischen Impulse, die bis heute von dieser Episode ausgehen.
Im Ausstellungsraum entfaltet sich ein Essay entlang von Fragen, die die Geschichte von Robotron betreffen, aber auch für ein Verständnis der technologisch geprägten Gegenwart relevant sind. Er beleuchtet Zusammenhänge von Geopolitik und Weltmarkt, die krisenhafte Produktion nach Plan in der DDR und die Rolle eines internationalen Wirtschaftsembargos. Dabei stellt er gängige Vorstellungen infrage, die sich in der Erzählung einer „sozialistischen“ Vergangenheit festgesetzt haben.
Das Projekt Robotron. Code und Utopie ist eine Kooperation der GfZK – Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig mit dem HMKV Hartware MedienKunstVerein Dortmund. Initiiert von Jochen Becker. Die Ausstellung ist unter dem Titel Robotron. Arbeiterklasse und Intelligenz vom 14.3– 26.7.26 im HMKV zu sehen. Im Februar 2026 erscheint eine die Ausstellung begleitende Publikation bei Spector Books.
Gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes. Gefördert von dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Gefördert durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig. knowbotiq wurde unterstützt von Pro Helvetia. Sandra Schäfer wurde unterstützt vom Medienboard Berlin-Brandenburg.
Biografien der beteiligten Künstler*innen
Karl-Heinz Adler (1927 Remtengrün, Vogtland – 2018 Dresden) war Künstler, Erfinder und Pädagoge und gilt heute als ein bedeutender Vertreter der konstruktiv-konkreten Kunst. Er beschäftigte sich mit Strukturen, die sich aus wiederholenden Elementen zusammensetzen. Neben seinem freien künstlerischen Schaffen verfolgte er in den 1950er Jahren – in enger Zusammenarbeit mit Friedrich Kracht – die angewandte Konzeption der „produzierenden Systeme“. Gemeinsam entwickelten sie ein variables System von Beton-Formsteinen, das die Architektur in der DDR prägte. Seine Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland gezeigt.
Tina Bara studierte Geschichte und Kunstgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin und Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. In der DDR arbeitete sie als freiberufliche Fotografin und war in der oppositionellen Friedensbewegung aktiv, unter anderem bei „Frauen für den Frieden“. Im Juli 1989 siedelte sie nach West-Berlin über. Seit 1993 ist sie Professorin für künstlerische Fotografie an der HGB. Seit 2000 nimmt Bara regelmäßig an Ausstellungen teil, veröffentlicht Bücher und führt Kunst- und Lehrprojekte im In- und Ausland.
Horst Bartnig (1936 Milicz, Polen – 2025 Berlin) absolvierte eine Malerlehre und studierte an der Fachschule für angewandte Kunst Magdeburg. Ab Mitte der 1960er Jahre wurde er zu einem wichtigen Vertreter der konkreten Kunst. Inspiriert von Mathematik, Physik und den technologischen Entwicklungen Ende der 1970er Jahre realisierte er seine ersten Computergrafiken. Bartnig war Mitglied im Verband Bildender Künstler in der DDR. Seine Werke finden sich in Sammlungen wie der Neuen Nationalgalerie Berlin, der Bundeskunstsammlung oder dem Haus Konstruktiv Zürich.
Carlfriedrich Claus (1930, Annaberg-Buchholz – 1998 Chemnitz) gilt als Mitbegründer der visuellen Poesie. Er schuf filigrane Arbeiten auf Transparentpapier, das er beidseitig dicht bezeichnete und beschrieb. Parallel dazu entstand ein akustisches Werk. Er war Teil des Kollektivs Clara Mosch, das vor allem in Karl-Marx-Stadt aktiv war. In den Jahren nach der politischen Wende 1989/1990 wurden dem Künstler zahlreiche Ehrungen zuteil. Er war Mitglied der Akademie der Künste, Berlin, und neben namhaften Kunstpreisen wurden ihm eine Ehrenprofessur des Freistaates Sachsen und das Bundesverdienstkreuz verliehen.
Nadja Buttendorf ist ausgebildete Goldschmiedin und studierte Bildende Kunst an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle (Saale). In ihren Arbeiten hinterfragt sie Geschlechterkonstruktionen und Wertschöpfungsmechanismen des menschlichen Körpers in unserer digitalen Gesellschaft. Mit interaktiven Installationen und Videos macht sie Frauen in der Technikgeschichte sichtbar. Sie hat in zahlreichen Institutionen im In- und Ausland ausgestellt, u.a. im HKW Berlin, der Gaîté Lyrique in Paris, und dem Seoul Museum of Art.
Karl Clauss Dietel (1934 Reinholdshain, Glauchau – 2022 Chemnitz) zählt zu den bekanntesten deutschen Gestalter*innenn. Er entwarf DDR-Klassiker wie die als Simson Mokick bezeichneten Kleinkrafträder, Erika-Schreibmaschinen und Rundfunkgeräte, technische Kleingeräte, Logos, Produktgrafiken, freie Bildkunstwerke sowie architekturbezogene Arbeiten. Als erster und einziger Gestalter aus der ehemaligen DDR erhielt er 2014 für sein Lebenswerk den Bundesdesignpreis. Dietel nahm an zahlreichen (inter-)nationalen Ausstellungen teil. Seine Designklassiker sind in bedeutenden Museen vertreten.
Georg Eckelt (1932 Wischütz, Niederschlesien – 2012 Königs Wusterhausen) war einer der wichtigsten Sachfotografen der DDR. Ab den 1960er Jahren inszenierte und dokumentierte er Design- und Alltagskultur im Auftrag von Gestaltungsateliers, der Industrie, staatlichen Archiven sowie für zahlreiche Zeitschriften- und Buchpublikationen. Ein Großteil seiner Bilder findet sich in der Fotothek der in der DDR gegründeten Sammlung Industrielle Gestaltung, die 2005 an die Stiftung Haus der Geschichte am Standort Museum in der Kulturbrauerei in Berlin übertragen wurde.
Antye Guenther, alias (baby) DATA DIVA, ist eine glitzerliebende Wissens-Erfinderin und unzuverlässige Erzählerin, geboren in einem Land, das es nicht mehr gibt. Gerüchten zufolge war sie einst Versuchskaninchen in sowjetischen Gehirnversuchen und hinterfragt nun mit Freude die Bedingungen und Fiktionalitäten westlicher Wissens- und Datenregime. Mit einer Vorliebe für Unfug überschreitet sie schelmisch Disziplingrenzen, oft während sie billige Strassschmuckstücke als Teil einer fortlaufenden kollaborativen „Glitzer-als-(kommunale)-Fürsorgepraxis“ herstellt.
Su Yu Hsin ist Künstlerin und Filmemacherin. In ihrer forschungsorientierten Praxis untersucht sie die Beziehung zwischen Ökologie und Technologie. Ihre gleichermaßen analytischen wie poetischen Erzählungen nehmen die kritischen Infrastrukturen in den Blick, in denen Mensch und Nicht-Mensch zusammenkommen. Ihre Videoinstallationen wurden weltweit in Museen und auf internationalen Kunstbiennalen ausgestellt, darunter in der Bundeskunsthalle Bonn, im Centre Pompidou-Metz, im Museum of Contemporary Art Busan und auf der Taipei Biennale.
Francis Hunger verbindet in seiner Praxis künstlerische Forschung und Medientheorie mit den Möglichkeiten der Erzählung. In Installationen, Hörspielen, Performances und internetbasierter Kunst untersucht er die Anwendungsmöglichkeiten und Auswirkungen von digitalen Technologien wie künstlicher Intelligenz und zivilen Drohnen. Hunger unterrichtet an der AdBK München und ist Postdoktorand am Dataunion ERC-Projekt an der VUB in Brüssel. Seine Arbeiten werden regelmäßig international ausgestellt und er ist Co-Editor von www.carrier-bag.net.
Margret Hoppe studierte Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und am École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris. Sie widmet sich seit vielen Jahren der Architekturfotografie, häufig im historischen oder gesellschaftlichen Kontext. In Projekten wie „Die verschwundenen Bilder“ oder „Bulgarische Denkmale“ setzt sie sich mit dem Verschwinden von Kunst und Denkmälern im Rahmen von gesellschaftlichen Umbrüchen auseinander. Hoppes Arbeiten wurden u.a. bei der Biennale in Venedig 2024 und in zahlreichen europäischen Institutionen gezeigt. 2024 war sie Stipendiatin der Stiftung Bauhaus Dessau im Meisterhaus Muche.
knowbotiq (Yvonne Wilhelm, Christian Hübler) experimentieren mit Formen von Wissen, politischen Repräsentationen und epistemischem Ungehorsam. In unterschiedlichen Formaten – performative Settings, kritische Fabulationen, Erfindungen, Begegnungen – erforschen sie molekulare, psychotrope und derivative Ästhetiken. Sie nahmen u.a. an der documenta fifteen und der 49. Biennale von Venedig (Österreichischer Pavillon) teil und stellten im New Museum New York, im Kunstinstituut Melly (vormals Witte de With) und der Kunsthalle St. Gallen aus.
Irma Markulin absolvierte ihre Ausbildung u.a. an der Akademie der Bildenden Künste in Zagreb und der Kunsthochschule Weissensee Berlin. Sie arbeitet mit Bildern, die im kollektiven Gedächtnis verankert sind, und untersucht mit malerischen Mittel deren Inszenierung in unterschiedlichen politischen Kontexten. Markulins Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt und sie erhielt mehrere internationale Kunststipendien, zuletzt „Culture Moves Europe“ in den Jahren 2024/25 und das Stipendium des kroatischen Ministeriums für Kultur und Medien 2023.
Helga Paris (1938 Gollnow, Pommern – 2024 Berlin) nimmt in der deutschen Fotografie eine herausragende Rolle ein. Sie gilt als Chronistin der Nachkriegszeit in Ostdeutschland und fotografierte über mehrere Jahrzehnte hinweg die Menschen und das alltägliche Leben in der Großstadt. Bis auf wenige Ausnahmen und ohne formale Ausbildung arbeitete sie ausschließlich im Eigenauftrag, denn ein Markt für ihre Bilder existierte in der DDR nicht. Dennoch war ihr Werk schon zu DDR-Zeiten außerordentlich populär. Ihre Fotografien waren in Ausstellungen und Büchern weltweit zu sehen. 2019 ging das Negativ-Archiv als Schenkung der Künstlerin an die Akademie der Künste, deren Mitglied sie seit 1996 war.
A. R. Penck (Ralf Winkler, 1939 Dresden – 2017 Zürich) war Maler, Zeichner, Bildhauer, Grafiker, Super-8-Filmer, Musiker und Autor. In seiner Lebens- und Kunstpraxis verband er analytisches und bildnerisches Denken, Ideen aus Philosophie, Naturwissenschaft, Informationstheorie und Technik. 1980 verließ Penck die DDR und siedelte in die Bundesrepublik über. Penck wird zu den Vätern der „Jungen Wilden“ und zu einem der wichtigsten künstlerischen Chronist*innen der jüngeren deutschen Geschichte gezählt. Seine Werke befinden sich in Sammlungen wie dem Museum of Modern Art, New York, dem Stedelijk Museum, Amsterdam und der Hamburger Kunsthalle.
Ramona Schacht und Luca Bublik verbinden in ihrer gemeinsamen Praxis künstlerische und sozialwissenschaftliche Forschung. Seit mehreren Jahren arbeiten sie mit Archiven und Bildbeständen, die Arbeit in der DDR und der Sowjetunion dokumentieren. Schacht studierte Fotografie an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst Leipzig bei Heidi Specker und war Preisträgerin des Dokumentarfotografie Förderpreise der Wüstenrot Stiftung 2023/2024 und des MdbK Leipzig (Connect) 2018. Ihre Arbeiten wurden u.a. bei Urbane Künste Ruhr und im Kunsthaus DAS MINSK, Potsdam gezeigt. Luca Bublik promovierte an der Bauhaus-Universität Weimar und arbeitet als freischaffender Autor und Kurator. Zuletzt beteiligte er sich u.a. künstlerisch bei Urbane Künste Ruhr 2025, und kuratierte die Ausstellung Reading the Spinnerei zur Arbeits- und Betriebsfotografie von Rita Große im Archiv Massiv Leipzig.
Rita Große eröffnete 1974 nach abgeschlossener Meisterprüfung im Fotografenhandwerk ein Fotolabor im Leipziger Waldstraßenviertel. Damit war sie in den 1970er und 1980er Jahren eine der wenigen selbstständigen Auftragsfotografinnen der DDR. Neben Großbetrieben wie der Baumwollspinnerei Leipzig oder dem Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) fotografierte sie für verschiedene Kombinate, Museen, das Denkmalamt, Banken, Hotels, Gastronomie oder begleitete Bauprojekte wie den Bowlingtreff in Leipzig. Ihr Fotostudio betrieb sie bis 2005. Danach war sie weiterhin als Industrie- und Architekturfotografin tätig.
Sandra Schäfer beschäftigt sich in Film, Fotografie und künstlerischer Forschung mit den Herstellungsprozessen von städtischen und transregionalen Räumen, Geschichte und Bildpolitiken. 2018 schloss sie ihren künstlerischen PHD zu Militanten Bild- und Raumpolitiken an der HfbK Hamburg ab. Schäfer ist Professorin an der Akademie der Bildenden Künste München und assoziiertes Mitglied des feministischen Filmverleihs Cinenova in London. Ihre Arbeiten werden regelmäßig bei Festivals wie der 66. und 67. Berlinale (Forum Expanded), Berlin, und in Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Sie publizierte zahlreiche Bücher, u.a. bei Archive Books Berlin, Camera Austria Graz und Spector Books.
Suzanne Treister arbeitete zunächst als Malerin und wurde Anfang der 1990er Jahre zu einer Pionierin im Bereich der digitalen Medien und des Internets. Sie verwendet verschiedene Medien wie Video, Zeichnung und Aquarell, um die Beziehung zwischen neuen Technologien, alternativen Glaubenssystemen und der Zukunft der Menschheit zu erforschen. Mit spekulativen Neuinterpretationen der Geschichte untersucht sie die Existenz verdeckter Kräfte, die in der Welt am Werk sind. Ihre Arbeitenwurden in zahlreichen Institutionen ausgestellt, darunter in der Tate Modern, London, auf der 14. Shanghai Biennale, 2023 und dem Centre Pompidou, Paris.
Werner Tübke (1929 Schönbeck, Elbe – 2004, Leipzig) war Mitbegründer der Leipziger Schule. Nach einer Malerlehre studierte er an der Kunsthochschule in Leipzig und Greifswald. Er ist bekannt für seinen Malstil in der Tradition der Renaissance und des Manierismus. Seit Anfang der 1970er Jahre feierte Tübke internationale Erfolge und Museen im In- uns Ausland erwarben seine Bilder. Sein monumentales Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen wurde 1989 fertiggestellt.
Marion Wenzel studierte Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Prof. Evelyn Richter. Angeregt von ihrer Professorin begann sie Anfang der 1980er Jahre die Tagebaue im Süden Leipzigs zu fotografieren. Über mehrere Jahrzehnte hinweg schuf sie ein Archiv, das die menschengemachten Veränderungen der Landschaft und die damit einhergehenden Umweltzerstörungen sichtbar macht. Von 2005 bis 2025 war Wenzel als Sammlungsfotografin für die Universität Leipzig tätig, für die sie in zahlreichen Aufnahmen die Universitätsgeschichte, etwa den Abtransport des Karl-Marx-Reliefs, den Abriss der sozialistischen Campusgebäude sowie den Bau des Paulinums dokumentierte.
Ruth Wolf-Rehfeldt (1932 Wurzen – 2024 Berlin) schuf ein vielfältiges Oeuvre aus Malerei, Zeichnungen, Collagen und sogenannten Typewritings. In diesen mit Schreibmaschine auf Papier angefertigten Arbeiten verband sie Poesie, Grafikdesign und Konzeptkunst. Mit ihrem Partner Robert Rehfeldt war sie Teil der internationalen Mail-Art-Bewegung in der DDR, die einen internationalen künstlerischen Austausch und die unzensierte Verbreitung von Kunst und Ideen ermöglichte. Nach 1989 stellte Wolf-Rehfeldt ihre künstlerische Arbeit vollständig ein. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgestellt, u.a. in DAS MINSK, Potsdam, und bei der documenta 14, Kassel, und finden sich in Sammlungen wie der Bundeskunstsammlung und dem Museum Luwdig, Köln. 2022 wurde sie mit dem Hannah-Höch-Preis ausgezeichnet.
Galerie für Zeitgenössische Kunst
Museum of Contemporary Art
Karl-Tauchnitz-Straße 9–11
04107 Leipzig
www.gfzk.de
Bild: Antye Guenther, Operation Zwiebelmuster, Recherchecollage, 2025
ROBOTRON. CODE UND UTOPIE
... in der GfZK Galerie für Zeitgenössische Kunst
Veröffentlicht am: 26.10.2025
Ausdrucken: Artikel drucken
Lesenzeichen: Lesezeichen speichern
Feedback: Mit uns Kontakt aufnehmen
Twitter: Folge uns auf Twitter
Facebook: Teile diesen Beitrag auf Facebook
Hoch: Hoch zum Seitenanfang