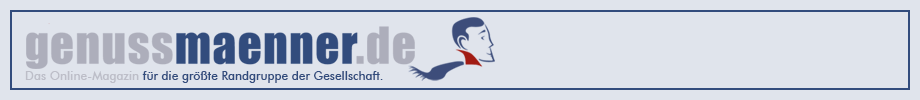Albert Fürst nahm im Jahr 1939 ein Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie auf. Nach gerade einmal zwei Semestern wurde er zum Kriegsdienst eingezogen. In Skizzen und Studien hielt er seine Eindrücke fest, fertigte Porträts an, zeichnete Soldaten an der Kriegsfront und dokumentierte die teils zerstörten Landschaften. Nach Kriegsende setzte er das Studium in Düsseldorf fort. Vor allem die Lehre der klassischen Gattungen wie Porträt- und Landschaftsmalerei prägten sein künstlerisches Schaffen dieser Zeit.
1948 wechselte Fürst für das Lehramtsstudium nach Köln und trat schließlich 1953 – zurück in Düsseldorf – in den Schuldienst ein. Sein künstlerisches Schaffen entwickelte sich trotzdem kontinuierlich weiter. Durch seine Mitgliedschaft und Kontakte in der Künstlervereinigung Künstlergruppe Niederrhein 1953 e. V. (ab 1955 Gruppe 53) knüpfte Fürst wichtige Kontakte in die Düsseldorfer Kunstszene, so zum Beispiel zu einigen Vertretern der informellen Kunst wie Gerhard Hoehme (1920–1989) und Peter Brüning (1929–1970). Ab 1956 war er Vorsitzender derGruppe. Der Austausch lieferte entscheidende Inspirationen zur Entwicklung seiner eigenen, vom Gegenstand gelösten Bildsprache. „[D]ie informelle Malerei […] [machte mich] aufmerksam auf die Möglichkeit der Befreiung, der Häutung, der Wandlung“ 1, resümierte Albert Fürst im Jahr 1985. In der informellen Malerei entdeckte der Künstler die Ausdruckskraft der Geste und er begann, seinen Fokus zunächst vor allem auf das Material Farbe und den Bildträger zu legen. Anstelle einer vorgrundierten Leinwand wählte Fürst grobes, unbehandeltes Sackleinen, auf das er Farbe und Farbpigment pastos auf eine Schicht aus Leim auftrug. Dafür reduzierte er die Farbpalette anfänglich auf Schwarz und Weiß. Nach kurzer Zeit traten auch Buntfarben wie Rot und Gelb, seltener auch Blau und Grün hinzu. Es ist die wörtlich zu nehmende Verbindung groben Materials mit einer gestischen, formauflösenden Malerei, die Spontaneität und gleichzeitige Kontrolle während des Malprozesses erahnen lässt. Die Leinwand ist dabei nicht nur Trägermedium des Malmaterials, sondern ein wesentlicher Bestandteil der eigenständigen Bildidee.
Auch bei der Arbeit auf Papier setzte der Künstler den Gestaltwert des Bildträgers bewusst ein. Die kaum zu überblickende Zahl an Papierarbeiten im Gelasamtwerk lässt den Schluss zu, dass er in dem leichter zu handhabenden Medium größtmögliche Flexibilität und die Freiheit zum Experiment fand. Es entstanden Arbeiten auf Papieren unterschiedlichster Dicke, Haptik und Farbe. Fürst wählte Acrylfarbe, arbeitete mit Gouache oder Tusche, schabte in die noch nasse Farbe, setzte breite Pinsel ein, trug die Farbe mit einer Walze auf, kratzte einzelne Farbschichten wieder ab und zeichnete mit Bleistift, Kohle, Wachskreide oder dünnem Faserstift über die Malschicht. Kurzum: Die Arbeit auf dem Papier bot unendliche Möglichkeiten zum spontanen Ausdruck. Dazu äußerte Fürst: „[M]eine ästhetischen Informationen und Botschaften [sind] persönlicher, daher echter, wenn sie vom Fluß und der Bewegung und aus Papier, Grund und Farbe sich ergebenden Strukturen getragen sind […].“2
Das Einschreiben der Geste in die Malerei bildete ein wichtiges Prinzip seiner Arbeitsweise. Dem Künstler ging es jedoch nicht um die Umsetzung eigenständiger (Schrift-) Zeichen in einem Bild, sondern vielmehr um eine Suche von Zeichenhaftem in der Malerei, das im Prozess des Malens gefunden oder entwickelt wird. Die Kunst des Informel hat den Bildbegriff zu einem offenen und prozessual gedachten erweitert. Darin fand Albert Fürst eine Möglichkeit seinen eigenen Malprozess neu zu denken. Mit der Betonung einzelner Bildelemente wie der Linie, dem Farbmaterial und Bildträger entwickelte er eine eigene Position innerhalb der informellen Kunst. In der Grundkonzeption und in seiner Arbeitsweise blieb er dem
Informel bis ins Spätwerk hinein treu. Während in seinen druckgrafischen Arbeiten auch figurative Elemente zurückkehrten, finden sich zeichen- und schriftartige Elemente in der Malerei eher subtil. Deutlich wird damit, dass er die informelle Kunst nicht als Dogma verstand, sondern in ihr das Potenzial erkannte, neue Wege der Formfindung und Formsetzung künstlerisch zu erkunden.
Dr. Anne-Kathrin Hinz
Forschungsstelle Informelle Kunst
Kunsthistorisches Institut der Universität Bonn
Albert Fürst
1920 geboren in Homburg (Saar)
1939 – 1949 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Franz Doll und Martin Paatz, später bei Wilhelm Schmurr und Heinrich Kamps, dazwischen
1940 – 1946 Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft
1948 – 1951 Studium der Romanistik und Philosophie an der Universität zu Köln und der Universität Sorbonne, Paris
1953 – 1958 Mitglied der Künstlervereinigung „Gruppe 53“, Düsseldorf, Leitung der Gruppe von 1956 bis 1957
Seit 1953 Schuldienst in Düsseldorf (Gymnasium – Kunst, Französisch) bis 1982, danach freischaffend
1958 – 1962 Mitglied der Künstlervereinigung „neue gruppe saar“, Saarbrücken
1975 – 1990 Vorsitzender des Künstlervereins „Malkasten“
2014 gestorben in Düsseldorf
Werke von Albert Fürst befinden sich u. a. im Kunstpalast Düsseldorf, Städel-Museum Frankfurt am Main, Museum Küppersmühle Duisburg, Museum Reinhard Ernst Wiesbaden, Gustav-Lübcke-Museum Hamm.
Kultur Bahnhof Eller
Vennhauser Allee 89
40229 Düsseldorf
www.kultur-bahnhof-eller.de
Bild: la joie | Acryl auf Leinwand | 100 x 80 cm | 2005
ALBERT FÜRST „LEBENDIGED INFORMEL“
Die Aufklärung gibt es im Kultur Bahnhof Eller
Veröffentlicht am: 19.10.2025
Ausdrucken: Artikel drucken
Lesenzeichen: Lesezeichen speichern
Feedback: Mit uns Kontakt aufnehmen
Twitter: Folge uns auf Twitter
Facebook: Teile diesen Beitrag auf Facebook
Hoch: Hoch zum Seitenanfang