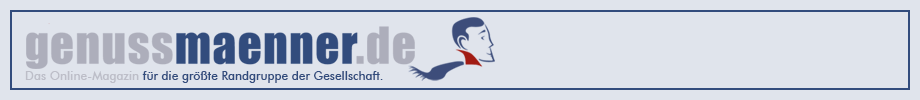Gründe für eine Untervermietung gibt es viele: Zusammen ist man weniger alleine und schont gleichzeitig den Geldbeutel. Vor allem in großen Städten ist ein neuer Mitbewohner schnell gefunden.
Doch was gilt rechtlich? Dürfen Mieter ihre Wohnung einfach untervermieten oder benötigen sie dafür die Zustimmung ihres Vermieters? Wolfgang Müller, Rechtsexperte der IDEAL Versicherung, klärt auf.
Rechtliche Grundlage: Erlaubnis des Vermieters einholen
Wer Teile seiner Wohnung untervermieten möchte, hat grundsätzlich gute Karten. Allerdings muss der Vermieter zustimmen, sonst droht eine Abmahnung oder sogar die Kündigung. Dies ist in § 540 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) geregelt: „Der Mieter ist ohne die Erlaubnis des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch der Mietsache einem Dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu vermieten.“ „Hat der Mieter ein berechtigtes Interesse an der Untervermietung, ist der Vermieter jedoch verpflichtet, ihm seine Zustimmung zu erteilen“, erläutert Wolfgang Müller. In welchen Fällen ein berechtigtes Interesse vorliegt, ist zwar nicht festgelegt. „Bei persönlichen und wirtschaftlichen Gründen, wie dem Einzug des Partners oder bei finanzieller Not aufgrund eines Jobverlusts oder Kurzarbeit, ist davon aber grundsätzlich auszugehen“, so der Rechtsexperte der IDEAL Versicherung. Dem Wunsch, eine Wohngemeinschaft zu gründen, muss der Vermieter ebenfalls meist zustimmen.
Ablehnen darf der Vermieter eine Untervermietung beispielsweise aus folgenden Gründen:
- Untervermietung der kompletten Wohnung
- Befürchtung, der häusliche Frieden werde beeinträchtigt
- Überbelegung der Wohnung
Lehnt der Vermieter trotz berechtigtem Interesse ab, kann der Mieter von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.
Informationspflicht
Wie bei jeder Regelung gibt es auch bei der Untervermietung und der erforderlichen Erlaubnis des Vermieters Ausnahmen: Handelt es sich bei dem neuen Mitbewohner um einen nahen Verwandten, Hausangestellten oder Pflegepersonal, benötigt der Mieter keine Erlaubnis. Zu den nächsten Familienangehörigen zählen Ehepartner, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern. „Dennoch haben Mieter in solchen Fällen eine sogenannte Informationspflicht gegenüber dem Vermieter“, weiß Müller. „Denn dieser hat das Recht zu wissen, wer in seiner Wohnung lebt.“ Mieter sollten ihren Mitbewohner daher konkret benennen. Am besten teilen sie dem Vermieter schriftlich Namen und Beruf der Person mit.
Untermietzuschlag
Stimmt der Vermieter einer Untervermietung zu, darf er im Gegenzug die Wohnungsmiete erhöhen. Der Mieter wiederum hat das Recht, diesem Untermietzuschlag zu widersprechen. Allerdings darf er dann auch keinen Untermieter aufnehmen. Als Richtwert gilt: Die Erhöhung kann bis zu zehn Prozent der Nettokaltmiete oder 20 Prozent der erzielten Untermiete betragen. „Eine Ausnahme gibt es beim Einzug von Lebensgefährten. Hier darf der Vermieter nur die Nebenkosten erhöhen“, erläutert der IDEAL-Experte.
Vertraglich festhalten
Sind die Formalitäten geklärt und die Rahmenbedingungen festgelegt, empfiehlt es sich, einen schriftlichen Vertrag mit dem Untermieter abzuschließen. Denn als Hauptmieter haftet er alleine gegenüber dem Vermieter. Das heißt: Verursacht der Untermieter einen Schaden in der Wohnung oder stört den Hausfrieden, treffen die Konsequenzen den Hauptmieter. Außerdem muss dieser auch dafür sorgen, dass die Miete pünktlich gezahlt wird. Wolfgang Müller rät daher: „Der Vertrag sollte den Hauptmietvertrag zum Bestandteil haben. Außerdem sollten zusätzlich Regelungen zu Betriebskosten, Schönheitsreparaturen und Mieterhöhungen sowie Miete, Zahlungstermin und Kaution enthalten sein.“ Grundsätzlich stehen Untervermieter und Untermieter in einem normalen Vermieter-Mieter-Verhältnis zueinander, inklusive der dazugehörigen Rechte und Pflichten. Der Untermieter kann zum Beispiel auch seine Miete mindern, wenn die von ihm angemieteten Räume Mängel aufweisen.
Mehr Rechts-Tipps im IDEAL Magazin.
Quelle: © filmfoto/ istock.com