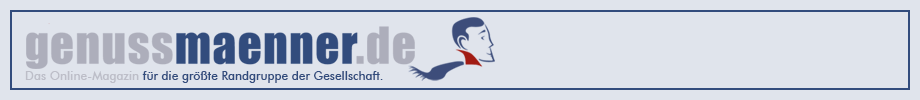Unfallforscher der Axa-Gruppe, einer der größten internationalen Versicherungskonzerne der Welt, untersuchen seit Jahren regelmäßig mit Crashtests Gefahren im Straßenverkehr. In zwei Untersuchungen nahmen sie diesmal Stärken, Schwächen und Risiken durch die wachsende Zunahme von Elektroautos auf unseren Straßen unter die Lupe. Die Ergebnisse geben zu denken.
„Der Siegeszug der Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Wir Versicherer und unsere Kundinnen und Kunden müssen damit aber auch neue Risiken beherrschen: E-Autos erzeugen zwar hierzulande nicht mehr Unfälle, können oftmals aber zu teureren Einzelschäden führen“, weiß Nils Reich, Vorstand Sachversicherung, bei AXA in Deutschland.
Während in Fahrschulen immer noch Bremswegberechnungen gelehrt werden, weil sich Gefahren auf der Straße mit zunehmender Geschwindigkeit potenzieren, zeigt sich beim batteriebetriebenen Auto eine komplett gegensätzliches Problem. Die größten Unfallrisiken bei E-Autos entstehen nämlich nicht beim Verringern der Geschwindigkeit, sondern beim Beschleunigen. Elektroautos haben ein sehr hohes Drehmoment, das sich unmittelbar bemerkbar macht. Es kann daher zu einer ungewollten, ruckartigen Temposteigerung kommen, die den Fahrer oder die Fahrerin überfordert.
Dieser Effekt dürfte auch die Ursache für die erhöhte Schadenfrequenz bei leistungsstarken Elektroautos sein. Denn ein Blick in die Unfallstatistik der AXA Schweiz zeigt, dass bei Elektroautos 50 Prozent mehr Schäden am eigenen Fahrzeug entstehen als bei jenen von herkömmlichen Verbrennern.
Mit diesem Problem beschäftigte sich auch der erste Crashtest, bei dem simuliert wurde wie ein Tesla-Fahrer vermeintlich nur kurz auf das Strompedal drückte und durch die starke Beschleunigung die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen Kreisel zu, konnte nicht mehr bremsen und überfuhr das Hindernis in der Mitte. Folge: Das Auto überschlug sich und es kam aufgrund des unebenen Untergrundes zu einer starken Beschädigung des Unterbodens.
„Der Unterboden scheint die Achillesferse von Elektroautos zu sein, weil die Batterie dort nicht zusätzlich geschützt ist. Dessen sollten sich Autofahrer und Autofahrerinnen bewusst sein“, gab Michael Pfäffli, Leiter der Unfallforschung AXA Schweiz, zu bedenken. Die Hersteller seien daher aufgerufen, die Gefahr von unten nicht zu unterschätzen und einen adäquaten Schutz sicherzustellen, beispielsweise indem der Unterboden mit einer Titanplatte oder ähnlichen Materialien mit hoher Widerstandsfähigkeit versehen wird. Die AXA-Unfallforscher empfahlen zudem, beim European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ein zusätzliches Crashtest-Szenario zur Überprüfung der Stabilität von unten einzuführen. Wird nämlich die Batterie beschädigt, könnte ein immenser Brand entstehen.
Allerdings: Das Brandrisiko bei Autos, unabhängig davon, ob sie benzin- oder strombetrieben sind, ist sehr gering und wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft überschätzt. Nur fünf von 10.000 Autos fallen statistisch gesehen einem Brand zum Opfer, ein Marderschaden kommt 38-mal häufiger vor als ein Autobrand.
Elektroautos haben nicht nur ein anderes Beschleunigungsverhalten, auch ihre Konstruktion und das Gewicht unterscheiden sich von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor erheblich. Autos werden generell immer schwerer. Verglichen mit Fahrzeugen Jahrgang 2000 (im Schnitt 1340 Kilogramm) sind neuere Autos rund 25 Prozent schwerer. Die Elektromobilität verleiht diesem Trend zusätzlich Schub. Die AXA-Unfallforscher gehen davon aus, dass das durchschnittliche Gewicht eines Neufahrzeuges aufgrund des Batteriebetriebes in wenigen Jahren bei zwei Tonnen liegen wird.
Mit dem Gewicht beziehungsweise dem Gewichtsunterschied zwischen Fahrzeugen befasste sich der zweite Crash. Ein Golf VII mit Verbrennungsmotor und ein typengleiches Modell mit Elektroantrieb prallten mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h frontal aufeinander. Der Elektro-Golf hat zwar exakt dieselben Abmessungen, ist aber wegen seiner Batterie und der höheren Steifigkeit 400 Kilogramm schwerer. Der 1250 Kilogramm wiegende Verbrenner-Golf ist bei diesem Crash einer deutlich höheren Belastung ausgesetzt und erleidet folglich einen sichtbar größeren Blechschaden als sein elektrisches Pendant. Dafür sorgt ein Grundgesetz der Physik: Die Wucht des Einschlags – der Impuls – ergibt sich aus der Multiplikation von Gewicht und Geschwindigkeit. Die Aufprallenergie des E-Autos ist also rund ein Drittel größer.
Fazit des Axa-Crashtests 2022: Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos sollten sich der unbeabsichtigt schnellen Beschleunigung bewusst sein. Der Umgang mit dieser unmittelbar auftretenden Kraft muss gelernt werden. Wer ein Elektroauto lenkt, sollte einen besonderen Augenmerk auf den Unterboden richten. Straßeninseln, Steine oder Kreisel sollten sie oder er besonders vorsichtig befahren, um eine Beschädigung des Unterbodens zu verhindern.
Und nicht zuletzt: Ein schweres Elektroauto bietet tendenziell eine höhere Eigensicherheit, weil schwerer. Gerade deshalb sollten sich jeder der Verantwortung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmern bewusst sein, die ein leichteres Fahrzeug bewegen. Sie sind im Falle eines Crashs benachteiligt. (Hans-Robert Richarz, cen)
Foto: Autoren-Union Mobilität/AXA
Elektroautos mit Risiken
Die Physik fährt immer mit
Veröffentlicht am: 30.08.2022
Ausdrucken: Artikel drucken
Lesenzeichen: Lesezeichen speichern
Feedback: Mit uns Kontakt aufnehmen
Twitter: Folge uns auf Twitter
Facebook: Teile diesen Beitrag auf Facebook
Hoch: Hoch zum Seitenanfang