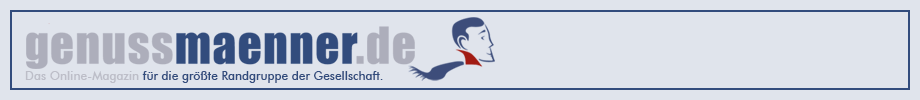Alleine im Jahr 2020 trank jeder Deutsche trotz der Corona-Krise und den damit einhergehenden Schließungen der Kneipen und Brauereien noch durchschnittlich 94,6 Liter Bier.
Im europäischen Vergleich konsumierten nur die beiden Nachbarländer Tschechien und Österreich mehr. Woher das beste Bier kommt, darüber streiten Bierliebhaber und Biersommeliers schon lange. Den Tag des Internationalen Bieres am ersten Freitag im August feiern trotzdem alle gemeinsam. Die ARAG Experten mit einem Überblick.
Biergeschichte
Die ersten nachweisbaren Überlieferungen von Bier und dessen Herstellung beginnen schon vor circa 6.000 Jahren. Die allerersten Bierbrauerinnen finden sich im alten Ägypten. Dort galt Bier als Grundnahrungsmittel und es war Männern nicht erlaubt, das Hopfengetränk zu brauen oder zu verkaufen. In Babylonien erließ König Hammurabi (1728 bis 1686 v. Chr.) bereits strenge Biergesetze. Heute gelten sicher andere Gesetze als damals, aber ums Bier gestritten wird immer noch.
Deutsches Reinheitsgebot – Wirbel um Craftbier
Nicht nur beim Konsum, auch in Sachen Bierproduktion hat Deutschland die Nase vorn. 1.528 Bierbrauereien wurden im Jahr 2020 vom Statistischen Bundesamt registriert. Bei über 5.000 Biermarken hat man mittlerweile die Qual der Wahl. Neben den üblichen Biersorten gibt es mittlerweile viele Sorten ausländischer Biere. Und genau dieses Craftbier hat die Welt des deutschen Biertrinkers vor etwa 30 Jahren kurzzeitig ins Wanken gebracht. ARAG Experten erklären warum: Im Jahr 1516 erließ der bayerische Herzog Wilhelm IV. eine Herstellungsverordnung, die besagte, dass Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser gebraut werden darf. Das sogenannte Reinheitsgebot setzte sich auch in anderen Regionen Deutschlands durch, sodass im Jahr 1906 eine andere Brauart per Gesetz verboten wurde. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) im März 1987 forderte nun aber Deutschland dazu auf, den Import und Verkauf ausländischer Biere zuzulassen, die nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut sind. Eine große Konkurrenz für die deutschen Bierbrauer, die um ihre Existenz und Tradition fürchteten. Heute blickt die Branche allerdings gelassen auf die ausländische Konkurrenz.
Sein eigenes Bier brauen – Ist das erlaubt?
Grundsätzlich darf jeder als Brauer oder Mälzer tätig sein. Es ist kein Braumeistertitel nötig, obwohl Ausbildungen in dem Bereich angeboten werden. ARAG Experten weisen jedoch auf einige Aspekte hin, die es zu beachten gibt. Die Bezeichnung „Bier“ ist geschützt und neben Bestimmungen aus dem Lebensmittelrecht und den Hygienevorgaben des Gesundheitsamtes muss man sich an die Bierverordnung (BierV) halten. Sie gibt beispielsweise vor, welche Getränke als Bier bezeichnet werden dürfen. Zudem ergeben sich ab einer Produktion von 200 Litern pro Person und Kalenderjahr, unabhängig davon, welches Bier gebraut wird, steuerliche Verpflichtungen. Darüber hinaus darf das Bier nur im eigenen Haushalt oder in einem nichtgewerblichen Gemeindebrauhaus hergestellt werden. Sobald man mehr als diese Freimenge produziert, unterliegt man der Biersteuerpflicht, die im Biersteuergesetz geregelt ist. Aufwendiger wird es, wenn das Bier tatsächlich gewerblich hergestellt und verkauft werden soll.
Ab wann darf man Bier trinken?
Das Jugendschutzgesetz (JuSchG) macht hier klare Vorgaben, was den Kauf und Konsum von Alkohol bei Jugendlichen in Deutschland betrifft. So dürfen Jugendliche, die jünger sind als 16 Jahre, in der Öffentlichkeit kein Bier trinken. Diese Altersgrenze sinkt auf 14 Jahre, wenn personensorgeberechtigte Erwachsene – wie z. B. die Eltern – den Jugendlichen in ein Restaurant oder eine Kneipe begleiten. Die ARAG Experten weisen darauf hin, dass im Ausland oft andere, meist höhere Altersgrenzen (z. B. Spanien 18 Jahre, USA 21 Jahre) gelten, und raten sich vorab genau zu informieren.
Darf Bier bekömmlich sein?
Neben dem Streit, welche Zutaten in ein Bier dürfen, welche nicht und was auf dem Etikett stehen muss, wird auch darum gerungen, wie man es für den Käufer bewirbt. So darf ein alkoholisches Bier laut dem Bundesgerichtshof (BGH) nicht mit dem Wort „bekömmlich“ beworben werden (BGH, Az.: I ZR 252/16). Der Fall: Eine Privatbrauerei aus dem Allgäu hatte mit den Werbeslogans „Bekömmlich, süffig – aber nicht schwer“ oder „[…] erfrischend bekömmlich für den großen und kleinen Durst“ ihr Bier vermarktet. Ein Verbraucherschutzverband sah darin aufgrund des Gesundheitsbezuges einen Verstoß gegen die Health-Claims-Verordnung der Europäischen Union . Die Karlsruher Richter stimmten dem Verband zu. Mit dem Wort „bekömmlich“ assoziiere der durchschnittliche Verbraucher, dass das Produkt gesund sei, weil es vom Verdauungssystem gut aufgenommen und auch bei dauerhaftem Konsum gut vertragen werde.
In einem anderen Fall hatte eine Privatbrauerei aus Nordrhein-Westfalen ihr alkoholfreies Bier auf der Verpackung als „vitalisierend“, „erfrischend“ und „isotonisch“ bezeichnet und als Testimonials die Boxsportler Vitali und Wladimir Klitschko eingesetzt. Die Werbeaussage suggeriere eine Verbesserung des Gesundheitszustandes, den es so nicht gebe, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Hamm und verbot die Form einer solchen Vermarktung auch für alkoholfreies Bier (OLG Hamm, Az.: 4 U 19/14).
Foto: Pixabay